Wie wir mit dem permanenten Ausnahmezustand umgehen
Von Leif Kramp und Stephan Weichert
Für viele Menschen in Deutschland stellt der Krieg in der Ukraine eine psychische Belastung dar. Der 22-jährige Jurastudent Paul berichtet, er habe seine Mediennutzung seit dem Krieg stark zurückgefahren, regelmäßige Nutzungsrituale wie den täglichen Abruf der Tagesschau-App sogar „komplett eingestellt“. „Ich möchte mir das nicht mehr antun“, sagt Paul, den seit Beginn der Pandemie die Sorge umtreibt, in seiner Studentenbude in Rostock – weit weg von seinem Elternhaus – völlig zu vereinsamen. Vor allem junge Menschen wie Paul informieren sich über das Krisengeschehen hauptsächlich in den digitalen Medien. Wenn er sagt, dass er mit „der Berichterstattung über die weltpolitische Lage derzeit überfordert“ sei, bebt Pauls Stimme. Der junge Mann ist hochgebildet, in seiner Kommune politisch aktiv. Er nutzt – normalerweise – mehrere journalistische Online-Angebote gleichzeitig, etwa das der FAZ und der Ostsee-Zeitung. Er sei auch „größter Fan öffentlich-rechtlicher Angebote“, die er ausschließlich über die Mediatheken abruft. Er achtet in seinem digitalen Mediennutzungsverhalten sehr auf die Vertrauenswürdigkeit der Informationsquelle.
Aber seit einigen Wochen ist Paul medial ausgepowert: Corona, Ukraine-Krieg, Migration, Energiekrise, soziale Polarisierung, wirtschaftliche Ungleichheit, Existenznöte – unsere Gesellschaft befindet sich in einem permanenten Ausnahmezustand, wir taumeln von einer Krise in die nächste. Wie viele andere Bundesbürger ist Paul mit dieser Negativitätsspirale überfordert. Sein psychisches Unwohlsein und das andauernde Erschöpfungsgefühl bis hin zu seiner Angst vor Vereinsamung werden von den Dynamiken der Berichterstattung zusätzlich getriggert. Seit Wochen nutzt er digitale Medien wie Instagram, WhatsApp und YouTube nicht aus Informationsgründen, sondern fast aus-schließlich zu Eskapismuszwecken, indem er sich „irgendeinen Quatsch“ anschaut, um sich abzulenken.
Wie Paul geht es auch vielen anderen Menschen, die nach zwei Jahren Pandemie-Berichterstattung des Nachrichtengeschehens überdrüssig und müde werden: Die amerikanische Medienwissenschaft hat für deren Folgen den Begriff der News Fatigue gefunden, also Nachrichtenmüdigkeit, die sich im schlimmsten Fall zu einem echten News Burnout auswachsen kann. Das ist der Fall, wenn die Nachrichtenlage sowohl das persönliche Wohlbefinden als auch die psychische Widerstandskraft von Nutzern so sehr beeinträchtigt, dass viele von ihnen einfach ganz abschalten.
„Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise – die Gesellschaft befindet sich in einem permanenten Ausnahmezustand.“
Auch wir können nun nachweisen, dass es vielen Deutschen so ergeht: Sie fühlen sich vom Nachrichtengeschehen emotional „erschlagen“ und wenden sich ab, weil ihre persönliche Coping-Kompetenz, also ihre Widerstandskraft (Resilienz) im Umgang mit digitalen Medien, merklich nachlässt: In den vergangenen Monaten haben wir eine Repräsentativbefragung zu „Digitaler Resilienz in der Mediennutzung“ durchgeführt, für die 935 von insgesamt 1.001 angesprochenen Bundesbürgern Angaben zu Aspekten ihrer digitalen Medienkompetenz und psychischen Resilienz gemacht haben. Im Anschluss führten wir 60 Tiefeninterviews mit ausgewählten Teilnehmenden, um die persönlichen Umstände und Folgen digitaler Mediennutzung zu erfragen.
Es stellt sich heraus, dass Deutschland, was die digitale Mediennutzung angeht, regelrecht zwiegespalten ist: Gerade in der jetzigen weltpolitischen Lage sind neue Handlungsqualitäten gefragt, vor allem was die Selbstbestimmtheit im Umgang mit digitalen Medien und die Informationsüberfrachtung vieler Menschen angeht.
Zentrale Erkenntnisse liefert die Untersuchung hinsichtlich der Souveränität der Nutzung digitaler Medien, insbesondere bei den am häufigsten genutzten sozialen Netzwerken und Messengerdiensten: Denn nicht nur Student Paul beklagt ein wachsendes Unwohlsein „wegen der Fülle an unterschiedlichen Themen“, auch andere von uns befragte Personen berichten von emotionalen Abhängigkeiten aufgrund ihres teils massiven täglichen Internet-Konsums und der ständigen digitalen Verfügbarkeit.
Einigen der Befragten geht es nach dem ausgiebigen Konsum sozialer Netzwerke nach eigenen Angaben „schlechter als vorher“, manche berichten von depressiven Verstimmungen, andere wiederum zwingen sich zu festen digitalen Auszeiten. Ein kleiner Teil gibt zu, dass sie wie Paul zunehmend feststellen, „den ganzen Tag am Handy zu hängen“, ohne zu wissen warum. Sie versuchen daher, ihre digitale Medienzeit generell runterzufahren – oder sich mit Tricks zu behelfen: „Wenn ich fahrig werde, bringe ich mein Handy in den Keller und hole es erst nach 30 Minuten als bewussten Akt wieder nach oben“, sagt die 31-jährige Finanzbeamtin Kerstin aus Hessen.
Auch wenn wir im Hinblick auf die aktive Einteilung von Medienzeit ein souveränes Nutzungsverhalten feststellen können, gelingt es längst nicht allen, sich von ihren digitalen ‚guilty pleasures‘ zu befreien: „Ich schaue mir regelmäßig die Statistik auf meinem Smartphone an und wundere mich, wie sehr ich doch am Handy hänge“, sagt die 24-jährige Studentin Pia. Gerade Messengerdienste wie WhatsApp sind bei vielen unserer Befragten das Hauptkommunikationsinstrument. Auch Instagram nutze sie gern, sagt Pia, TikTok mache Spaß, sei jedoch ein Zeitfresser. Den nur schwerlich zu realisierenden Wunsch nach gelegentlicher digitaler Entkoppelung bei gleichzeitig selbstbestimmter Entschleunigung bestätigen viele der Befragten.
In Konturen zeichnet sich in unserer Studie deutlich ab, dass die digitale Medienvielfalt mit einer gewissen Hilflosigkeit und Ohnmacht daherkommt: Es ist nicht die Diskursfreudigkeit, die unsere Befragten in den sozialen Netzwerken stört, sondern die unverblümte Ausdrucksweise mancher Zeitgenossen und auch das Risiko, einer Falschinformation auf den Leim zu gehen. Hass und Hetze werden als Geißel der Digitalisierung gesehen, weil sie eine gesamtgesellschaftliche Spaltung in atemberaubender Geschwindigkeit vorantreiben. Die Befragungsergebnisse zeigen auch, wie daraus emotionale Unschärfen in der Selbstwahrnehmung entstehen: Zwar gibt die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen an, im sozialen Netzwerk ihrer Wahl zur Ruhe zu kommen. Doch mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe findet, dass sie soziale Netzwerke zu viel oder deutlich zu viel nutzt.
Im Lichte der Krise stellt sich für uns die Frage, wie professionelle Medien zu einer Stärkung der Widerstandskraft auf Nutzerseite beitragen. Schon aus eigenem Antrieb, Reichweiten für Nachrichtenangebote zu steigern, braucht es journalistische Strategien, um die Bevölkerung sicher durch die digitale Aufmerksamkeitsökonomie zu geleiten. Die Beziehung zwischen Journalismus und Publikum durch Dialog systematisch zu stärken, kann dafür lohnend sein. Schließlich ist die digitale Gesamtstrategie zu überdenken: Ein Instagram-, TikTok- oder YouTube-Kanal ist nur dann unterstützend, wenn er nicht dazu führt, dass sich die angestammten Nutzer entfremden, sondern originäre Akzente setzt.
Unser vorläufiges Fazit lautet: Robuster denken und handeln bedeutet für die Branche, Mediennutzende besser zu verstehen und von ihnen zu lernen. Wer in schwierigen Zeiten erstarken will, findet also in der Veränderungsbereitschaft ausreichend Stamina – nur eben nicht um jeden Preis: Ein resilienter Journalismus braucht ein resilientes Publikum und darf deshalb weder in alte Muster zurückfallen noch sollte er das Neue unkritisch umarmen. Die Bevölkerung in der Krise umfassend zu informieren bedeutet, ihr Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben, die sie kompetenter im Umgang mit der Digitalisierung machen. Und diese Mündigkeit ist gerade im Hier und Jetzt gefragt.
In der noch unveröffentlichten Grundlagenstudie des gemeinnützigen VOCER Instituts für Digitale Resilienz untersuchen die Medienforscher Leif Kramp (ZeMKI, Universität Bremen) und Stephan Weichert (Institut für Digitale Resilienz, Hamburg) in Kooperation mit dem Wort & Bild Verlag, wie deutsche Mediennutzende ihre Resilienz in Bezug auf ihr digitales Medienhandeln steigern können: Die in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa im Zeitraum 25. Oktober bis 15. November 2021 durchgeführte Repräsentativbefragung gibt Einblicke in Wahrnehmung, Motive und Implikationen rund um das Nutzungsverhalten unterschiedlicher Online-Angebote, etwa Messenger-Dienste, Social-Media-Plattformen, Streaming-Dienste und journalistische Nachrichten- und Informationsangebote.
Die zentralen Befunde und Daten zur Studie werden an dieser Stelle in Kürze veröffentlicht.
Dieser Text wurde zuerst im Medienmagazin „journalist“ veröffentlicht.
Leif Kramp forscht am ZeMKI, Universität Bremen, zur Transformation von Journalismus und Mediennutzung und ist Gründungsvorstand von VOCER. Stephan Weichert ist Medienwissenschaftler und Mitgründer des gemeinnützigen Instituts für Digitale Resilienz.


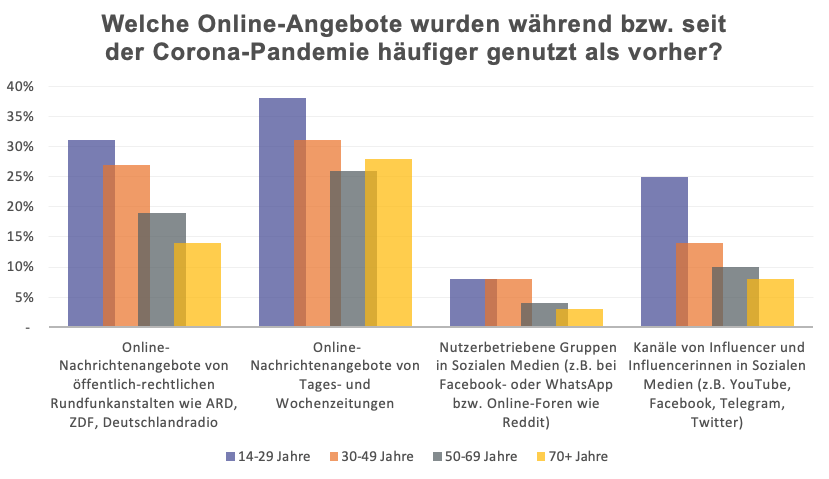


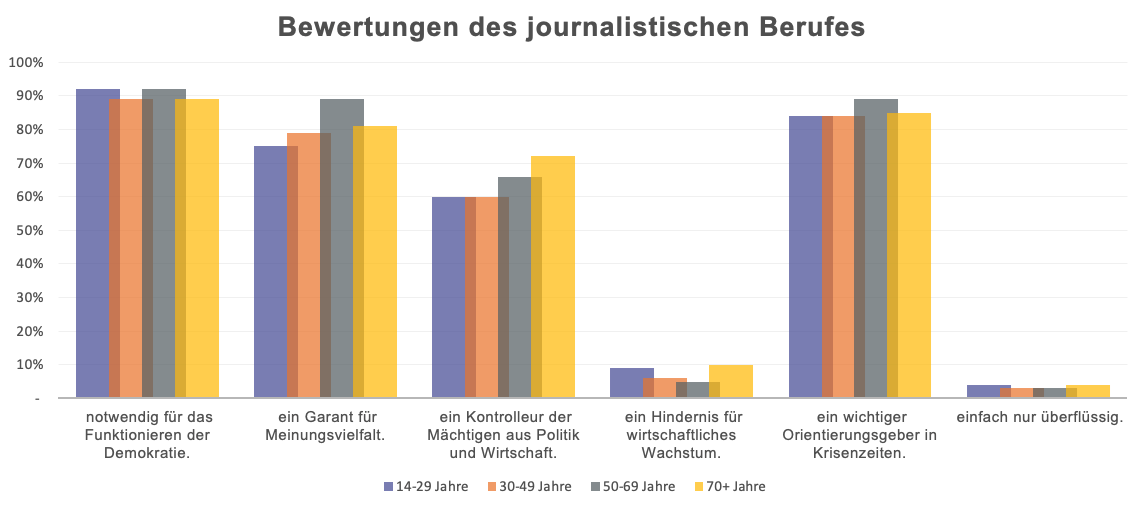


 Photo by Paul Skorupskas on Unsplash
Photo by Paul Skorupskas on Unsplash Jiawei Zhao / Unsplash
Jiawei Zhao / Unsplash